Glasfaserverstärkte Kunststoffe werden zum Beispiel in Autos, Flugzeugen oder Windrädern verbaut. Doch der Müll daraus lässt sich bisher kaum recyceln. Jetzt entwickelt ein Forschungsteam ein neues Verfahren mit heißem Plasma, das diesen Abfall umweltfreundlich wiederverwerten soll. Mit dem Ziel, ein großes Problem der Kreislaufwirtschaft zu lösen.
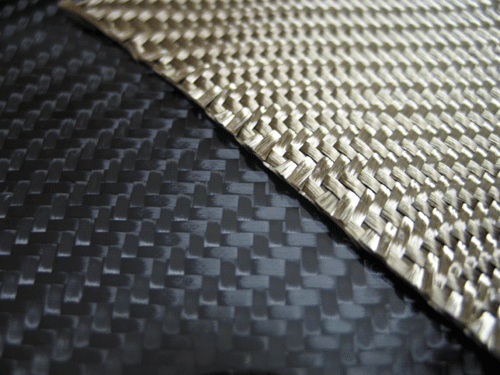
Stabil, leicht, aber bisher kaum recycelbar: Gewebte Struktur von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) l Foto Racingjeff via Wikimedia Commons
Eine Kreislaufwirtschaft ohne Emissionen und Rückstände. Das ist das Ziel des Forschungsprojekts PLS4PLAS, das am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald entwickelt wird. Gemeinsam mit dem Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik (IUTA) und der TU Bergakademie Freiberg will das Projektteam ein neuartiges Verfahren entwickeln, um glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) effizient zu recyceln. Die VolkswagenStiftung unterstützt das Vorhaben mit 1,37 Millionen Euro.
GFK-Abfälle (Glasfaserverstärkte Kunststoffe) stellen seit Jahren ein wachsendes Umweltproblem dar. Aufgrund ihres Verbunds aus Glasfasern und Kunststoffen lassen sie sich bislang kaum wiederverwerten. Sie landen auf Deponien oder werden verbrannt, mit erheblichen Umweltfolgen. „Es entstehen CO2-Emissionen und Schadstoffe, die wir künftig vermeiden wollen“, erklärt Dr. Diego Gonzalez, Projektleiter am INP. Die Lösung: ein Recyclingverfahren auf Basis von Plasma, das eine schonende Zerlegung der Materialien ermöglicht.
Im Zentrum steht ein „allothermer Gasifizierungsprozess“. Dabei wird ein Arbeitsgas auf mehrere tausend Grad Celsius erhitzt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Müllverbrennung erfolgt die Energiezufuhr von außen, wodurch eine kontrollierte Umwandlung des Kunststoffs in Synthesegas erfolgt. Dieses Gas kann als Rohstoff für neue Kunststoffe verwendet werden: Ein Kreislauf entsteht. Auch das zurückbleibende Glas kann wiederverwendet werden. So entsteht ein echtes Recycling – ohne Abfall, ohne Emissionen. Neben der technischen Umsetzbarkeit stehen ökologische und ökonomische Aspekte im Fokus. Das Team untersucht die Skalierbarkeit des Verfahrens und arbeitet an der Entwicklung eines industriellen Reaktors, um das Recycling im großen Maßstab zu ermöglichen. Zugleich werden mögliche Auswirkungen auf Industrien wie die Chemiebranche, die GFK-Herstellung und die Metallverarbeitung analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der gesellschaftlichen Akzeptanz: Inwieweit die Industrie das Verfahren übernimmt und ob es sich flächendeckend durchsetzen kann, soll untersucht werden.
„Wir wollen Technologien schaffen, die nicht nur funktionieren, sondern auch einen realen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten“, betont Prof. Klaus-Dieter Weltmann, wissenschaftlicher Direktor des INP. Als eines der führenden Institute für Niedertemperaturplasmen setzt das INP auf interdisziplinäre Lösungen für zentrale Herausforderungen in Umwelt, Energie und Materialtechnik. Mit PLAS4PLAS entsteht ein vielversprechender Ansatz, ein bislang ungelöstes Abfallproblem zu lösen – und neue Wege für die Kreislaufwirtschaft zu eröffnen.
Quelle: